Themen dieser Teilseite
Gelatinedruckverfahren mit Farbpulver
Der Pigmentdruck ist ein hochwertiges, photographisches Edeldruckverfahren, und funktioniert ähnlich wie das Chromatverfahren. Die durch ammoniakhaltige Dichromatlösung lichtempfindlich gemachte Gelatineschicht versetzen Sie mit einem echtfarbigen Pigment (Ruß / Kohle) und belichten mit einem Negativ. Nach dem Entwickeln in warmem Wasser entsteht ein seitenverkehrtes Pigmentbild als Relief, das durch Übertragen auf ein Hilfsblatt und von da auf gehärtetes Gelatinepapier seitenrichtig wird. Vorteil: Es besteht aus Pigmentfarbe und ist daher gegenüber den Silberhalogenid-Papieren alterungsbeständig.
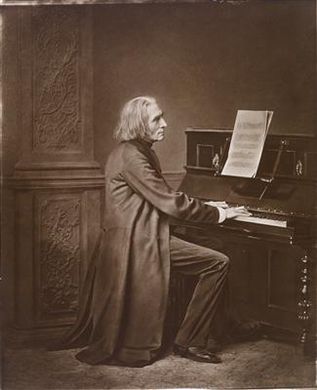
Ozotypie
Eine Variation des Kohledrucks erfand Thomas Manly um 1899. Später wurde das Verfahren vom Ozobromprozess abgelöst.
Ein Chromgelatinepapier belichtet man im Kontaktverfahren mit einem Negativ. Anschließend wird ein Tuch aufgepresst, das mit einer Mischung aus Kohlepigment, verdünnter Essigsäure und Hydrochinon getränkt ist. Dabei härtet die Chromgelatineschicht proportional zur Belichtung aus. Nach dem Auswaschen der unbelichteten (ungehärteten) Gelatineschicht verbleibt das Pigmentbild.
Öldruck und Bromöldruck
Zutaten:
- Gelatine
- Fettfarbe
Öldruck und Bromöldruck sind weitere Varianten dieser Herstellungsfamilie. Nun sind die Farbpigmente jedoch nicht in die Gelatineschicht eingelagert, ..“sondern sie werden nachträglich in Form von Ölfarbe auf die Gelatineschicht aufgestupst. Man macht sich dabei die gegenseitige Abstoßung von Fett und Wasser zunutze. Die gegerbten Stellen der Gelatine nehmen kein oder nur wenig Wasser auf, dafür umso mehr Fettfarbe und umgekehrt. Druckt man einen solchen Abzug in der Kupferdruckpresse auf ein neues Papier um, so hat man ein Blatt vor sich, das nur noch aus Papier und Farbe besteht. Bei einem solchen Bromöl-Umdruck ist die photographische Herkunft nicht mehr ohne weiteres zu erkennen..“

Staubverfahren / Anthrakotypie
„Bei dem Staubverfahren in der Fotografie mischt man chromsaures Salz mit Gummilösung und Traubenzucker und lässt diese Lösung auf Glas eintrocknen. Die Schicht verliert im Licht ihre Klebrigkeit.
Belichtet man sie unter einem positiven Bild, so bleibt sie unter den schwarzen Bildkonturen klebrig, und wenn man dann trockenes Farbenpulver aufstäubt, haftet dieses an den klebrig gebliebenen Stellen. Auf diese Weise kommt das Bild in der jeweiligen Staubfarbe zum Vorschein. Dieses Verfahren ist von Pizzighelli („Anthrakotypie und Cyanotypie“, Wien 1881) mit einigen Abänderungen unter dem Namen Anthrakotypie zur Herstellung von Lichtpausen auf Papier benutzt worden.
Hat man ein negatives Bild als Original benutzt, so erhält man wiederum ein negatives Bild. In dieser Form bildet das Staubverfahren auf Glas ein wichtiges Hilfsmittel zur Reproduktion der zerbrechlichen fotografischen Negative.
Stäubt man mit Porzellanfarbe ein, so erhält man ein einbrennbares Bild, das nach dem Überziehen der Schicht mit Kollodium sich unter Wasser leicht vom Glas ablösen und auf andere Flächen (Porzellan- und Glasgeschirr) übertragen und einbrennen lässt. So erhält man die eingebrannten Bilder auf Glas und Porzellan. Nach Grüne fertigt man nach einem Negativ mit Hilfe der Camera obscura ein positives Kollodiumbild an. Dieses wird in eine Platinlösung getaucht, und hier reduziert das Silber der Bildkonturen das Platin. Dieses schlägt sich an den Bildstellen nieder, und so entsteht ein Platinbild, das sich vom Glas abziehen, auf Porzellan übertragen und einbrennen lässt.“
(Langzitat aus Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Staubverfahren)
Anmerkung:
Die Onlineversion basiert auf dem ersten Buchmanuskript von 1997 und ist mit dem Buch nur noch in Ansätzen vergleichbar. Die Seiten dieses Webauftritts enthalten oft nur wenige, kurze Absätze. Das Buch ist zweispaltig gedruckt, damit die Informationen zwischen zwei Buchdeckel passen. Das Buch enthält hauptsächlich „Input“ – die Website dient als ergänzender ‚Bildspeicher‘.
Erhältlich ist das Buch in erweiterten 7.Auflage mit 232 DIN-A4-Seiten.
Sicherheitshinweis:
Informieren Sie sich vor der Anwendung der Rezepturen unbedingt auch aus anderen Quellen! Beachten Sie das Kapitel ➥ Vorsicht Chemie!
Die Rezepturen sind der (historischen) Fachliteratur entnommen, sind nur teilweise selbst getestet und können (Übertragungs-)Fehler enthalten.
Quellenangaben zur Herkunft der Rezepturen finden Sie im Buch. Ich empfehle dringend, sich vor Anwendung der Rezepturen stets die Etiketten, Warnhinweise und Anleitungen durchzulesen, die mit den Chemikalien geliefert werden und fachkundigen Rat einzuholen. Chemikalien (und auch Naturstoffe) können karzinogen, erbgutschädigend und gesundheitsschädlich sein. Verwenden Sie Handschuhe und weitere Schutzmaßnahmen wie Mundschutz etc.
Der Einkaufswagen (🛒 ➜) weist auf Bezugsquellen hin. Es handelt sich um sog. „Affiliate-Links“. Falls Sie dort einkaufen, erhalte ich ein geringe Provision. Damit wird ein Teil der Serverkosten dieses Webangebots gedeckt.
Falls Ihnen Sätze meiner Website aus der Wikipedia bekannt vorkommen: Zahlreiche Artikel zum Themengebiet habe ich für die Wikipedia (mit-)verfassst.
Texte und von mir erstellte Abbildungen der Webseite unterliegen meinem © Copyright. Ich freue mich über Anregungen, Kritik, Hinweise und Bestellungen ;-)